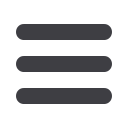
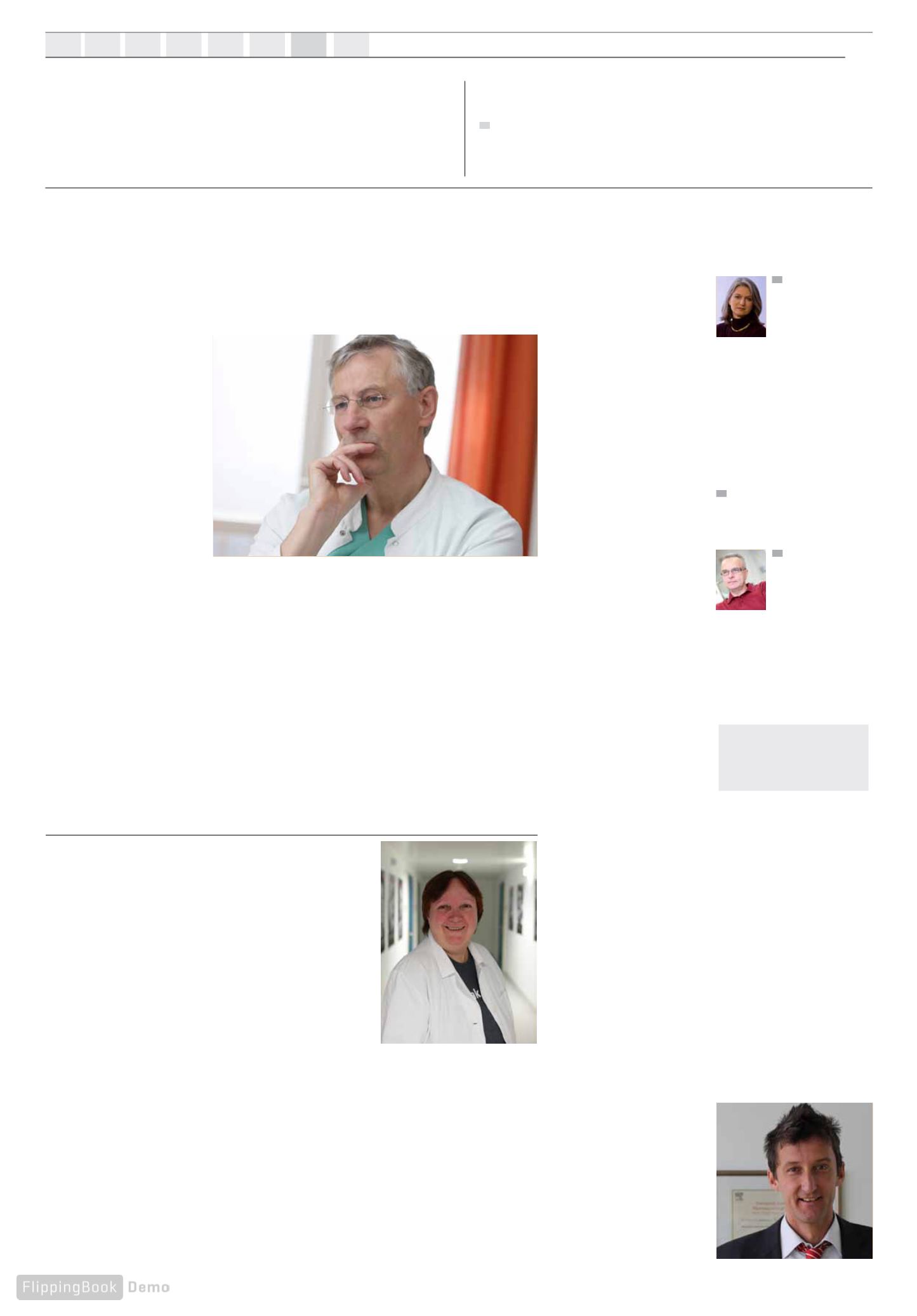
3 2 1
4 5 6
7
8
0213
standort
Bucinator – eine Produktneuheit made in Tirol
Thema: [ LIFE SCIENCES TIROL ]
Der Bucinator ist eine technische Innovation, die in Zukunft in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und auch zu
Hause Stürze von Patienten aus Pflegebetten verhindern soll. Entwickelt wurde die patentierte Technologie-Innovati-
on von Johannes Hilbe – ehemaliger Krankenpfleger, studierter Pflegewissenschaftler und Medizin-Informatiker –, der
sich in der Zwischenzeit nach Unterstützung durch das Gründerzentrum CAST nach Teilnahme am Businessplan-
wettbewerb adventureX als Jungunternehmer selbstständig gemacht hat.
Science
Monika Ritsch-Marte,
Leiterin der Sektion für
Biomedizinische Physik an
der Medizinischen Univer-
sität Innsbruck, wurde auf
der Europäischen Konferenz
Biomedizinischer Optik (ECBO) in München
zum OSA Fellow ernannt. Die OSA, internatio-
nal renommierte und rund 18.000 Mitgliedern
aus 175 Ländern zählende optische Gesellschaft
mit Sitz in Washington, verleiht jährlich nur an
72 ihrer Mitglieder den Titel Optical Society
Fellow. Im Labor für „Biomedizinische Laseran-
wendungen“, das die gebürtige Vorarlbergerin
Ritsch-Marte gemeinsam mit Stefan Bernet
leitet, entstehen jene Technologien, die den
Einsatz von Licht für relevante (bio)medizinische
Anforderungen ermöglichen.
Der Molekularbiologe Martin Bodner vom
Institut für Gerichtliche Medizin wurde für sein
Forschungsprojekt zur Rekonstruktion der Aus-
breitung des Menschen in Südamerika mit dem
Theodor-Körner-Preis ausgezeichnet.
Seit Ende April steht
mit Alois Saria erstmals ein
Österreicher an der Spitze der
Internationalen Gesellschaft
für Neurochemie (ISN).
Der Leiter der Abteilung für
Experimentelle Psychiatrie an der Medizinischen
Universität Innsbruck wurde zum Präsidenten
der renommierten Vereinigung gewählt. Die
ISN ist die einzige internationale Gesellschaft
für den wachsenden Bereich der Neurochemie
und zählt weltweit rund 1500 ForscherInnen
und ÄrztInnen zu ihren Mitgliedern.
Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster
Life Sciences Tirol finden Sie auf
www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info
[
]
T
echnische
Pilotierung
einerkollaborativen Herz-
insuffizienz-Versorgung mit
mobilfunkbasiertem Telemonito-
ring – das klingt kompliziert, doch
der Grundgedanke dahinter ist be-
stechend einfach: Bringen wir die
Medizin zum Patienten. Das spart
dem Gesundheitssystem enorme
Kosten und erhöht die Lebensqua-
lität der Betroffenen.
Zudem kann dadurch die Zahl
der Krankenhausaufnahmen und
langfristig auch die Sterblich-
keitsrate bei einer schweren Er-
krankung, wie der sogenannten
„Herzschwäche“, gesenkt werden.
Herzinsuffizienz bezeichnet an
sich die krankhafte Unfähigkeit
des Herzens, die vom Körper benö-
tigte Blutmenge zu fördern. Der ge-
bräuchliche Begriff Herzschwäche
trifft den Sachverhalt allerdings
nur ungenau, weil nicht nur eine
verminderte Pumpfunktion (systo-
lische Herzinsuffizienz oder Herz-
muskelschwäche), sondern auch
eine gestörte Füllung des Herzens
(diastolische Herzinsuffizienz) bei
unbeeinträchtigter Pumpfunktion
zur Herzinsuffizienz führen kann.
„Rund ein Prozent der Bevölke-
rung im Alter von 45 bis 55 Jahren
leidet an dieser Herzschwäche, im
Alter von 80 Jahren sind mehr als
zehn Prozent betroffen. Allein in
Tirol ist von mindestens 15.000
Betroffenen auszugehen“, erklärt
Univ. Doz. Dr. Gerhard Pölzl. Der
Kardiologe leitet das Projekt „Herz
Mobil Tirol“ an der Uniklinik in
Innsbruck. Dieses Kooperations-
projekt der Medizinuni mit dem
Austrian Institut of Technology
(AIT, vormals Forschungszentrum
Seibersdorf) und der TILAK wird
derzeit vom Wissenschaftsfonds
des Landes Tirol finanziert. Ziel ist
es, dass Herzinsuffizienz-Patienten
nach dem Krankenhausaufenthalt
optimal zu Hause nachversorgt wer-
den, um Probleme und letztlich die
Re-Hospitalisierung zu verhindern.
„Die Wiederaufnahmerate bei die-
ser Erkrankung ist enorm hoch“,
erläutert Pölzl und ergänzt: „Und
häufig ist es so, dass die Patienten,
die dann in die Klinik kommen, be-
reits in einem kritischen Zustand
sind.“ Um dies in Zukunft verhin-
dern zu können, wurde nun in der
ersten Phase dieses Projektes eine
Koordinationsstelle an der Kardio-
logie in der Uniklinik eingerichtet.
Eine Gruppe von zehn Patienten
bekam für ein halbes Jahr ein von
der AIT entwickeltes Smartphone
zur Verfügung gestellt.
Dieses „KIT“ (Keep in Touch) ge-
nannte Gerät kombiniert die Vor-
teile einer elektronischen Daten-
erfassung mit den Möglichkeiten
eines herkömmlichen Mobiltele-
fons. Das Gerät ermöglicht eine
einfache und intuitive Datenüber-
nahme aus verschiedenen medi-
zinischen Geräten wie Blutdruck-
messgerät,
Blutzuckermessgerät
oder Waage. Dazu kommt eine
breite Palette der Datenerfassung
mittels RFID-Tags (ID-Karte, Er-
fassung der Medikation, des Wohl-
befindens, der Aktivität usw.). Die
dabei täglich übermittelten Daten
werden direkt an den zuständigen
Internisten/Hausarzt weitergelei-
tet, wobei der Klinik eine Koor-
dinationsrolle zukommt. Wenn
die Daten außerhalb einer vorab
definierten Norm liegen, können
notwendige Anpassungen rasch
umgesetzt werden. Dazu Gerhard
Pölzl: „Ziel ist es, dass man Pati-
enten mit Herzinsuffizienz, die ei-
nen stationären Aufenthalt hinter
sich haben, zu Hause so betreuen
bzw. unterstützen kann. Damit ist
es möglich, die Krankheit mög-
lichst stabil zu halten und für den
Patienten ist ein Höchstmaß an Si-
cherheit und damit Lebensqualität
gegeben.“
Es konnte nun in der ersten Pha-
se des Forschungsprojekts die tech-
nische Machbarkeit nachgewiesen
werden. Zudem zeigte sich, dass
Patienten, aber auch die einge-
bundenen Internisten/Hausärzte
dieses Angebot sehr gut anneh-
men. Daher soll nun in einer zwei-
ten und später dann dritten Pro-
jektphase von „Herz Mobil Tirol“
dieses Modell schrittweise auf ganz
Tirol ausgedehnt werden.
]
Univ.-Doz. Gerhard Pölzl ist der Leiter des Forschungsprojektes „Herz Mobil Tirol“.
Foto: Friedle
Beim Projekt „Herz Mobil Tirol“ der Kardiologie an der Klinik Innsbruck werden die Vital-Daten von Herz
insuffizienzpatienten via Smartphone überwacht, um bei drohender Gefahr frühzeitig einschreiten zu können.
Smartphone als Lebensretter
FAKTEN. NEWS.
[ Thema: Life Science ]
Foto: Meduni Innsbruck
Foto: Friedle
Ausgezeichnete Gendermedizin
[ konkret GEFRAGT ]
V
iele Menschen haben Angst
vor Spritzen. Das Problem:
Viele Wirkstoffe können
nur auf diese Art verabreicht
werden. Daher wird seit Jahren
verstärktim sogenannten Drug-De-
livery-Bereich für orale Wirkstoff-
Darreichungssysteme
geforscht.
Sehr erfolgreich ist dabei die Inns-
brucker Firma ThioMatrix.
Das Unternehmen hat vor über
zehn Jahren eine revolutionäre
Trägertechnologie für Medika-
mentenwirkstoffe entdeckt. Der
Vorteil: Sogenannte Thiomere zei-
gen eine verbesserte Anhaftung
an Schleimhäuten. Damit können
Einnahmefrequenz,
Einnahme-
menge und Nebenwirkungen von
Medikamenten reduziert werden.
Unter anderem entwickelt ThioMa-
trix Insulin-Tabletten, welche die oft
schmerzhaften Injektionen über-
flüssig machen. „Wie die meisten
Unternehmen in diesem Bereich
haben wir zwei Standbeine. Zum
einen verfeinern wir die von uns
entwickelte Thiomer-Technologie
weiter, und zum anderen entwickeln
wir auch für andere Pharma-Unter-
nehmen Darreichungsformen bzw.
-formulierungen“, erläutert Grün-
der und CSO Andreas Bernkop.
Das Beispiel ThioMatrix zeigt auch,
wie wichtig Jung-Unternehmer-För-
derung ist. „Nach zwei Preisen bei
Businessplanwettbewerben – einer
davon war der Tiroler adventureX –
war uns klar, dass die Gründung ei-
ner Firma auf jeden Fall Sinn macht.
Und wir erhielten dabei auch viel
Unterstützung“, erläutert Bernkop.
ThioMatrix ist heute weltweit tä-
tig und zu den über hundert Kun-
den zählen nahezu alle namhaften
Pharma-Unternehmen.
]
Pieksen unnötig
Die Firma ThioMatrix hat eine Technologie entwickelt,
die Spritzen in sehr vielen Fällen unnötig macht.
STANDORT:
Was muss man sich un-
ter Gendermedizin vorstellen?
Margarethe Hochleitner:
Gendermedizin stellt die Frage, ob
das, was wir in der Schulmedizin den
PatientInnen anbieten, auch wirklich
evidence-based ist, d. h. für Frauen und
Männer tatsächlich geprüft ist. Man darf
zum Beispiel nicht vergessen, dass noch
bis in die 1990er-Jahre Medikamente
überwiegend nur an Männern getestet
wurden. Gendermedizin versucht also
für Männer und Frauen auf Basis geprüf-
ter Studien bestmögliche Angebote in
Diagnose, Therapie und Prävention zu
bieten. Und dazu braucht es natürlich
erst einmal Forschung.
STANDORT:
Ist es aber nicht so, dass
es immer noch zu wenig Frauen in den
verschiedenen Bereichen des Gesund-
heitswesens bzw. der Forschung gibt?
Hochleitner:
Das ist sicher nicht
so einfach zu beantworten. Ich meine,
um dem allgemeinen Wunsch von Pa-
tientinnen zu entsprechen, von einer
Ärztin betreut zu werden, z. B. in der
Frauenheilkunde, braucht es die not-
wendige Anzahl an Ärztinnen. Zusätz-
lich gibt es eine gewisse Hoffnung, dass,
wenn Frauen in einer entsprechenden
Zahl in allen Gremien und Führungs-
positionen sind, Notwendigkeiten und
Mängel eher bemerkt werden. Wobei
die Frage der Frauengesundheit ja auch
in einem hohen Maße aus dem Grund-
gedanken der Frauendiskriminierungen
gekommen ist. Aber Gendermedizin ist
für mich in erster Linie ein völlig unpoli-
tisches Wissenschaftsparadigma.
STANDORT:
Nun gibt es den Be-
griff Frauengesundheit und später
Gendermedizin aus den USA kom-
mend ja schon seit den 1960er-Jahren.
Sie setzen sich auch schon sehr lange
damit auseinander. Wie bewerten Sie
den derzeitigen Stand bzw. wo sehen
Sie noch Nachholbedarf?
Hochleitner:
Natürlich ist es, so
wie bei allen Dingen, am Anfang im-
mer recht mühsam. Wobei es natürlich
nicht darum gegangen ist, jemanden
zu beschuldigen, sondern darauf hin-
zuweisen, dass es hier Fragen gibt, die
wissenschaftlich untersucht werden
müssen. Die Probleme hatten auch da-
mit zu tun, dass diese Forderungen sehr
eng mit der Frauenrechtsbewegung
verknüpft waren und damit mit der Er-
kämpfung von Posten und Positionen
im universitären Bereich. Inzwischen
haben alle Universitäten in Österreich
Gendermedizin im Lehrprogramm.
Hier in Innsbruck waren wir 2007 die
ersten, die es im Pflicht-Lehrprogramm
eingeführt haben. Ich glaube, dass wir
zumindest hier in Innsbruck im Kontext
Gendermedizin die Normalität erreicht
haben.
STANDORT:
Sie wurden als „Woman
Inspiring Europe 2013“ ausgezeichnet.
Was bedeutet das für Sie persönlich bzw.
was bedeutet so ein Preis für Ihre Arbeit?
Hochleitner:
Natürlich freut man
sich auch persönlich über die Anerken-
nung für die eigene Arbeit. Es zeigt aber
auch der eigenen Institution, dass die Ar-
beit von außen anerkannt und gesehen
wird. Diese Bestätigung macht die Ver-
handlungen um Ressourcen mit poten-
ziellen Geldgebern bzw. Partnern leich-
ter. Und es zeigt den Jungen, dass man
innerhalb einer Institution mit der nötigen
Konsequenz Veränderungen erreichen
kann, ohne gleich als Untergrundkämpfer
agieren zu müssen.
Foto: Friedle
Foto: Privat
Der Wissenschaftler Andreas Bernkop ent-
wickelte die neue Thiomer-Technologie.
Univ.-Prof. Margarethe Hochleitner, Di-
rektorin des Frauengesundheitszentrums
















